| (spätes 15tes Jahrhundert)
Bereits im 13ten Jahrhundert erfährt eine Mode langsam eine Renaissance, die bereits Jahrhunderte zuvor Einzug gehalten hatte, und schliesslich im 14ten Jahrhundert über die Grenzen Frankreichs hinweg sich grosser Beliebtheit erfreute: die Säume der Kleidung werden in runde, später blättrige und komplizierte Muster geschnittern, sie wird "gezaddelt". Diese Art von Mode lässt sich bereits z.B. in der Morganbibel um 1250-60 in Frankreich beobachten, in Handschriften und Berichten der Jahrhundertmitte des darauffolgenden Jahrhunderts jedoch vielfach verstärkt.
Um 1400 erlebt diese Mode schliesslich ihre volle Blüte, die bis zum Ende des Jahrhunderts andauern sollte. Die Verzierung der Kleidung erfährlich schliesslich solche Ausmaße, dass die Obrigkeit sich genötigt fühlt, durch Gesetze gegenzuwirken: so wendet sich auch die Nürnberger Kleiderordnung des 14ten und 15ten Jahrhunderts gegen diese Mode, was jedoch die Bürger nicht abhält, dagegen zu verstossen. Insbesondere wohlhabendere Stände weisen in der Statistik deutlich mehr Busgeld nach sich ziehende Vergehen durch Verstösse gegen die Kleider-und Luxusverordnung vor, als einfachere stände, die vor allem durch mehr oder weniger kleinere Gewaltverbrechen aufallen.
Neu im späten 15ten Jahrhundert ist die Praxis, die Kleidung durch simples Zerschneiden, dem "Zerhauen" zu "Zerhauenen Zeug" zu gestalten, eine Mode, die vermutlich über Italien bereits um und vor der Mitte des Jahrhunderts Einzug hielt, und für die Mode der Landsknechte nach 1500 schliesslich typisch wird. |
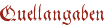
| Spätmittelalterliche Gemälde aus Nürnberg | Verschiedene Gemälde aus Nürnberg (Nürnberger Lorenzkirche, Germanisches Nationalmuseum), aus dem Zeitraum 1380-1500. |
| Nürnberger Kleiderordnung des 15ten Jahrhunderts | Auszüge aus der Nürnberger Kleiderordnung des 15ten Jahrhunderts |
| Nürnberger Polizeiordnung | Nürnberger Polizeiordnung des 13ten bis 15ten Jahrhunderts, Veröffentlichung von 1861. Bibliothek des Ltterarischen vereins Stuttgard. |
| Munderkinger Passion | Die Munderkinger Passion des gotischen Hochaltars, datiert auf 1473 |
| Oberrheinische Meister | Malereien oberrheinischer Meister, spätes 15tes Jahrhundert |
| Karlsruher Passion | Karlsruher Passion, spätes 15tes Jahrhundert |
|
|