| (spätes 15tes Jahrhundert)
Die Glockenkanne ist eines der besten Beispiele dafür, wie stabil die Formenvarianz funktioneller Alltagsgegenstände ist.
Diese Kannenform, die uns in Ausführungen aus Zinn im Verlaufe des 15ten Jahrhunderts in Darstellungen aus Süddeutschland und der Schweiz zunehmend begegnet, lässt sich schon zu wesentlich früheren Zeitpunkt, in diesem Falle jedoch aus Holz, nachweisen. Wesentliche Unterschiede in der Funktion sind die mit der Materialänderung möglichen konstruktiven Merkmale wie Sperriegel an dem Verschluss, oder der Klappverschluss an dem Ausguss.
Die Häufigkeit, mit der diese Kannenform im späten Mittelalter in Darstellungen auftaucht, spricht für eine besondere Beliebtheit, die sich bis in die Neuzeit fortsetzt, so daß diese Kannenform mit wenigen bis keinen konstruktiven Änderungen (wie z.B. einen Schraubverschluss anstelle des Bajonettverschlusses) bis in die späte Neuzeit weiterhergestellt wurde, insbesondere im Gebiet der Schweiz und dem Voralpenland. |
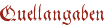
| Fabel von den zwei Mäusen | Fabel von den zwei Mäusen, Holzschnitt, Zainer Johannes (1472-93), Schwaben, Ulm |
| Cod. Nr. 2801 "Schachzabelbuch" | Das Schachzabelbuch (Cod. Nr. 2801, heute in Wien, Österreichische Nationalbibliothek), entstanden 1465, stellt Berufe in ihrem natürlichen Umfeld und mit ihren Werkzeugen dar. |
|
|